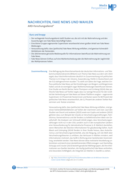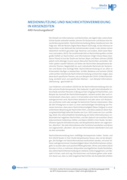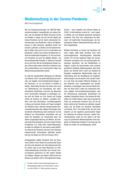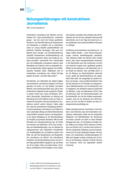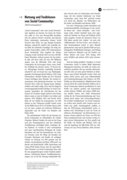Filter
6
Text search:
Uli
Gleich
Topics
Digital & Social Media Use, Internet Use
1
Media Socialisation, Media Biographies, Media Life Journeys
1
Media Use, Media Consumption
1
News Consumption & Information Sources of Media Users
1
Trust in the Media, Credibility of Media
1
Social Media
1
Disinformation, Misinformation, Fake News
1
Conspiracy Narratives, Conspiracy Theories
1
Effects of Disinformation on Democracy
1
Election Campaigns: Disinformation & Misinformation
1
Constructive Journalism, Solution-Oriented Journalism
1
COVID-19 Pandemic: Effects on Journalism, Media & Communication
1
Digital Media Reception
1
Media Psychology, Communication Psychology
1
Media Reception
1
Parasocial Interaction
1
Everyday Life
1
Perception, Cognition & Comprehension
1
Motivations
1
COVID-19 Pandemic: Economic, Political and Social Effects
1
Reality & Communication, Truth & Media
1
Language
Document type
Countries / Regions
Authors & Publishers
Media focus
Publication Years
Journals
Output Type
Nachrichten, Fake News und Wahlen
Media Perspektiven, issue 5 (2025), 10 pp.
"Voraussetzung dafür, dass (politische) Fake News Wirkung entfalten, sind gewisse Vulnerabilitätsfaktoren auf Seiten der Userinnen und User. Laut den Studien von Daunt und anderen (2023) sowie von Gupta und anderen (2023) gehören dazu zum Beispiel der Glaube an Verschwörungserzählungen, Patriot
...
Mediennutzung und Nachrichtenvermeidung in Krisenzeiten
Media Perspektiven, issue 4 (2025), 11 pp.
"Die Vielzahl von Informationen und Nachrichten, die täglich über unterschiedlichste Kanäle verbreitet werden, können für Nutzerinnen und Nutzer eine Herausforderung darstellen. Nachrichtenvermeidung (News Avoidance) kann die Folge sein. Wie der Reuters Digital News Report 2024 zeigt, ist das I
...
Medienrezeption
Baden-Baden: Nomos, 2., aktual. und erw. Aufl. (2025), 770 pp.
"Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über die Gegenstände und Theorien der Rezeptionsforschung. In den 37 Beiträgen wird ein systematischer Zugang zum State of the Art der jeweiligen Thematik aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive gelegt. Die umfassend aktualisierte u
...
Mediennutzung in der Corona-Pandemie
Media Perspektiven, issue 2 (2022), pp. 81-88
"Während der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat sich der Medienkonsum in allen Bereichen signifikant erhöht. Um auf dem Laufenden und mit anderen in Kontakt zu bleiben, aber auch um sich zu unterhalten und abzulenken, nutzten (und nutzen) die Me
...
Nutzungserfahrungen Mit Konstruktivem Journalismus
Media Perspektiven, issue 12 (2022), pp. 582-588
"Konstruktiver Journalismus unterscheidet sich vom traditionellen Journalismus dadurch, dass Nachrichten nicht nur mit negativer und konfliktbasierter Konnotation präsentiert, sondern konstruktive Auswege aufgezeigt werden. Er zeichnet sich durch spezifische Elemente in der Berichterstattung aus: L
...
Nutzung und Funktionen von Social Communitys
Media Perspektiven, issue 2 (2011), pp. 115-120
"Nach Angaben der Nielsen Company wurde Facebook 2010 von etwa 400 Millionen Menschen weltweit genutzt, für das laufende Jahr soll deren Zahl auf etwa 630 Millionen steigen. Laut der JIM-Studie 2010 sind Social Communitys die bevorzugten Seiten, wenn Zwölf- bis 19-Jährige das Internet nutzen. 70
...