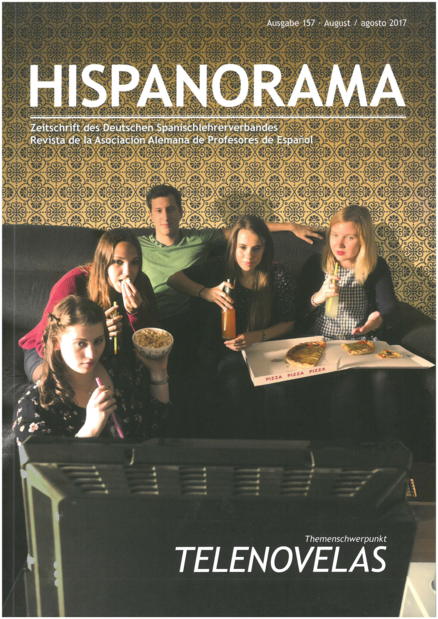Telenovelas
Hispanorama, issue 157 (2017), pp. 8-47
"Die Bedeutung von Telenovelas für die „Populärkultur" ist schon seit geraumer Zeit in den Fokus der insbesondere lateinamerikanistischen Forschung gerückt, maßgeblich zunächst von dem spanisch-kolumbianischen Medien- und Kulturwissenschaftler Jesus Martin-Barbero in den 1980er Jahren. Sein Ansatz ist insofern interessant, als er die populärkulturellen Medien, wie Kino, Radio und Presse als zentrale Vermittlungsinstanzen für die Ausbildung von kollektiver (d. h. nationaler) Identität in Lateinamerika in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, unter dem Vorzeichen der Modernität bzw. Modernisierung, bestimmt. Dem Medium des Fernsehens, das sich seit den 1960er Jahren verbreitet, diagnostiziert er eine Tendenz zur Homogenisierung, aber auch hier sagen die verschiedenen Genres, sowie ihre konkreten Artikulationen nicht nur etwas über hegemoniale Verhältnisse und die ideologische Manipulation der Kulturindustrie aus. Insbesondere Telenovelas sind ihm zufolge als kulturelle Produkte bedeutsam, die vermitteln zwischen einem „tiempo de vida" („de una socialidad negada, econ6micamente desvalorizada y politicamente desconocida, pero culturalmente viva") und einem „tiempo del relato, que la afirma y hace posible a las clases populares reconocerse en ella" (1993: 245) . In diesem Sinne kommt er zu dem Schluss, dass "lo que hace la fuerza de la industria cultural no se hallo solo en la ideologia, sino en la cultura, en la dinamica profunda de la memoria y del imaginario (Martin-Barbero 1993: 245 f.) . Seit den 2000er Jahren sind die Produktionen vielfältiger, innovativer geworden, im Zuge auch einer US-amerikanischen Serienkultur, und die Telenovelas integrieren zunehmend auch politische und historische Themen.
Der Frage, inwiefern diese neuen Entwicklungen in einem ähnlichen Sinne identitätsbildend und vermittelnd wirken, wie Martin-Barbero beschreibt, versucht sich der vorliegende Schwerpunkt anzunähern. Schon in den 1980er Jahren sind lateinamerikanische (vor allem brasilianische, aber auch mexikanische und venezolanische) Telenovelas massiv in andere Weltregionen exportiert worden und haben somit zugleich ein spezifisches Lateinamerika-Bild geprägt. So war die brasilianische Produktion Die Sklavin Isaura in den 1980er Jahren die erfolgreichste Telenovela aller Zeiten; aber auch die mexikanische Betty la fea erfreute sich in den 1990er Jahre größter Beliebtheit und führte zu einer Reihe von Adaptionen in verschiedenen Ländern, darunter die USA und Deutschland. Die Verbreitung dieser Serienproduktionen hat kontinuierlich zugenommen - und in vielen Regionen (auch in Deutschland) gibt es heute eine mehr oder weniger erfolgreiche „einheimische" Produktion. Der transkulturelle Charakter von Telenovelas zeigt sich nicht nur am „Export" dieser Produktionen in verschiedene afrikanische, osteuropäische und asiatische Länder, sondern auch an verschiedenen Adaptionen, bei denen der „Stoff" verkauft und als einheimische Produktion neu geschaffen und in den nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt wird. Andererseits werden unterdessen auch in Lateinamerika Telenovelas ins Programm aufgenommen, die aus anderen Regionen stammen; so sind z. B. in Chile seit einigen Jahren die „telenovelas turcas" ein neues Phänomen, das auf großes Interesse stößt und zunehmend populär geworden ist. Darüber hinaus sind sie auch deshalb als transkulturelle Produkte zu verstehen, weil sie auf universelle Werte (und Gefühle) zurückgreifen und bekannte Erzählstrukturen beinhalten, die ganz offensichtlich über Ländergrenzen und Kontinente hinaus attraktiv sind. Telenovelas aus den letzten Jahren zu geben - ohne dabei angesichts der unermüdlichen Produktion in Spanien und fast sämtlichen lateinamerikanischen Ländern auch nur annähernd Vollständigkeit beanspruchen zu können - oder gar auf spezifische soziologische Phänomene der Rezeption eingehen zu können. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den neueren Entwicklungen: den „Narconovelas" und ihre Bedeutung für eine transnationale Serien- und Populärkultur, sowie den Telenovelas als Medien politischer und historischer Bildung." (Seiten 8-9)
Der Frage, inwiefern diese neuen Entwicklungen in einem ähnlichen Sinne identitätsbildend und vermittelnd wirken, wie Martin-Barbero beschreibt, versucht sich der vorliegende Schwerpunkt anzunähern. Schon in den 1980er Jahren sind lateinamerikanische (vor allem brasilianische, aber auch mexikanische und venezolanische) Telenovelas massiv in andere Weltregionen exportiert worden und haben somit zugleich ein spezifisches Lateinamerika-Bild geprägt. So war die brasilianische Produktion Die Sklavin Isaura in den 1980er Jahren die erfolgreichste Telenovela aller Zeiten; aber auch die mexikanische Betty la fea erfreute sich in den 1990er Jahre größter Beliebtheit und führte zu einer Reihe von Adaptionen in verschiedenen Ländern, darunter die USA und Deutschland. Die Verbreitung dieser Serienproduktionen hat kontinuierlich zugenommen - und in vielen Regionen (auch in Deutschland) gibt es heute eine mehr oder weniger erfolgreiche „einheimische" Produktion. Der transkulturelle Charakter von Telenovelas zeigt sich nicht nur am „Export" dieser Produktionen in verschiedene afrikanische, osteuropäische und asiatische Länder, sondern auch an verschiedenen Adaptionen, bei denen der „Stoff" verkauft und als einheimische Produktion neu geschaffen und in den nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt wird. Andererseits werden unterdessen auch in Lateinamerika Telenovelas ins Programm aufgenommen, die aus anderen Regionen stammen; so sind z. B. in Chile seit einigen Jahren die „telenovelas turcas" ein neues Phänomen, das auf großes Interesse stößt und zunehmend populär geworden ist. Darüber hinaus sind sie auch deshalb als transkulturelle Produkte zu verstehen, weil sie auf universelle Werte (und Gefühle) zurückgreifen und bekannte Erzählstrukturen beinhalten, die ganz offensichtlich über Ländergrenzen und Kontinente hinaus attraktiv sind. Telenovelas aus den letzten Jahren zu geben - ohne dabei angesichts der unermüdlichen Produktion in Spanien und fast sämtlichen lateinamerikanischen Ländern auch nur annähernd Vollständigkeit beanspruchen zu können - oder gar auf spezifische soziologische Phänomene der Rezeption eingehen zu können. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den neueren Entwicklungen: den „Narconovelas" und ihre Bedeutung für eine transnationale Serien- und Populärkultur, sowie den Telenovelas als Medien politischer und historischer Bildung." (Seiten 8-9)
Telenovelas im 21. Jahrhundert / Karen Genschow, 8
La telenovela, eso que nadie ve pero todo el mundo sigue / Laura Soler Azorín, 12
Amar, recordar y llorar: kollektives Gedächtnis und Melodram in Telenovelas / Karen Genschow, 18
Narcotrafico y telenovelas en Colombia: entre narconovelas y "telenovelas de la memoria" / Mónika Contreras Saíz, 26
Narcoseries: machos sensibles y mujeres poderosas / Ainhoa Vásquez Mejías, 32
Herzschmerz im Klassenzimmer: Telenovelas aus didaktischer Perspektive / Karen Genschow & Giselle Zenga-Hirsch, 37
La telenovela, eso que nadie ve pero todo el mundo sigue / Laura Soler Azorín, 12
Amar, recordar y llorar: kollektives Gedächtnis und Melodram in Telenovelas / Karen Genschow, 18
Narcotrafico y telenovelas en Colombia: entre narconovelas y "telenovelas de la memoria" / Mónika Contreras Saíz, 26
Narcoseries: machos sensibles y mujeres poderosas / Ainhoa Vásquez Mejías, 32
Herzschmerz im Klassenzimmer: Telenovelas aus didaktischer Perspektive / Karen Genschow & Giselle Zenga-Hirsch, 37